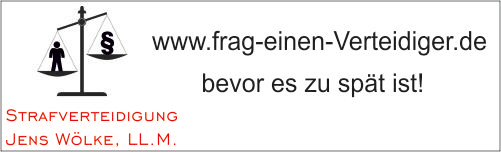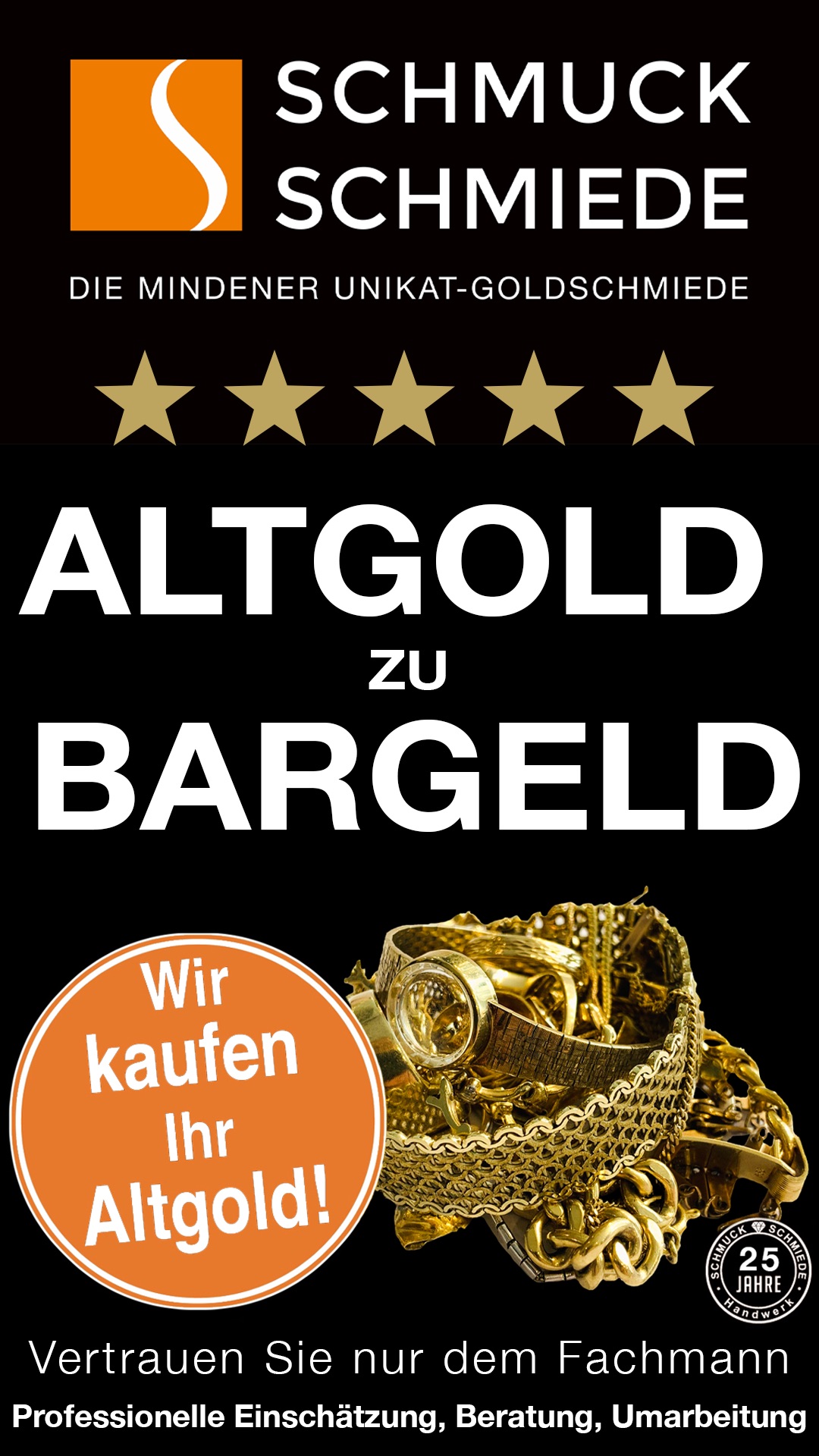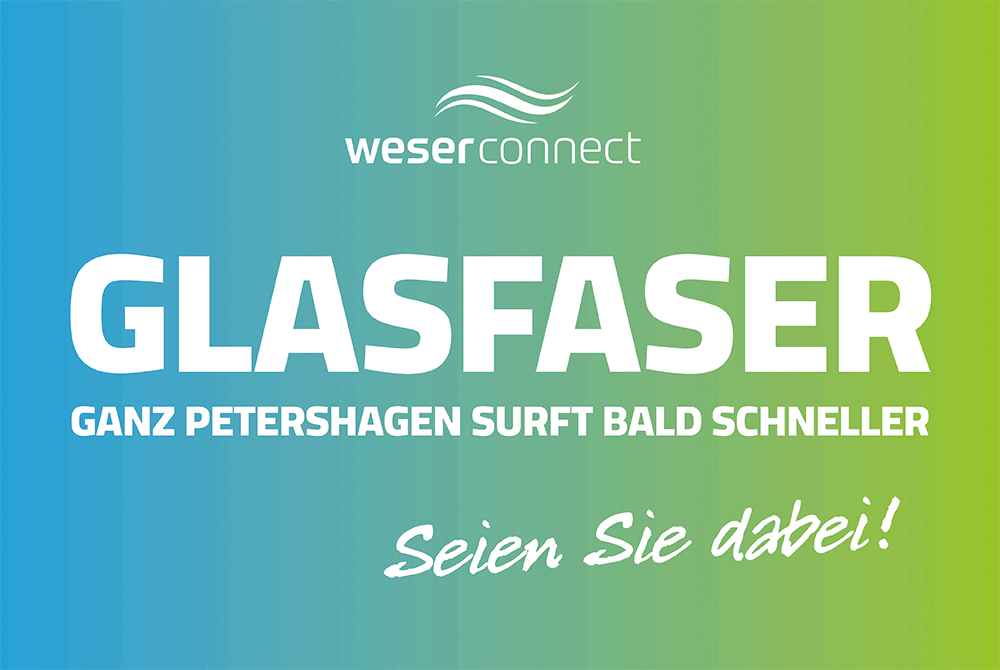Petershagen (hg). Die Energieversorgung steht derzeit im Fokus wie nie zuvor. Steigende Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten und der Klimawandel machen den Ausbau erneuerbarer Energien dringlicher. Deutschland soll, wie grade im Grundgesetz festgeschrieben, bis 2045 klimaneutral werden, doch der Weg dorthin ist herausfordernd. Die Solar- und Windenergie ist essenziell, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Energiepreise langfristig zu stabilisieren. Zudem fordert die Wirtschaft schnellere Genehmigungen für neue Anlagen, um den Ausbau zu beschleunigen und eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Um die Bedeutung erneuerbarer Energien auf lokaler Ebene greifbarer zu machen, habe ich mit verschiedenen Akteuren vor Ort gesprochen. Ihre Perspektiven und Herangehensweisen sind vielfältig, doch sie eint eine zentrale Erkenntnis: Der Ausbau nachhaltiger Energiequellen ist unerlässlich. Ihre Erfahrungen und Ideen fügen sich wie Zahnräder in ein großes System – ein System, in dem jedes Element die anderen beeinflusst.
Aus für Kraftwerk Heyden
Am Schleusenkanal in Lahde steht ein Werk, das jahrzehntelang die Energieversorgung der Region gesichert hat: Das Steinkohlekraftwerk Heyden. 1951 als erstes Kraftwerk nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb genommen, produzierte der erste Block Heyden 1 zunächst 120 Megawatt Leistung – gespeist aus Steinkohle. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Kapazität erweitert, bis Block 4 ab 1987 mit einer Nettoleistung von 875 Megawatt zur Stromversorgung beitrug. Die Stilllegung des Kraftwerks Heyden markiert einen gewichtigen Schritt in Deutschlands Energiewende. Während der Kohleausstieg politisch längst beschlossen war, war das Kraftwerk zuletzt aufgrund der Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine noch einmal in Betrieb genommen worden. Doch am 30. September 2024 war Schluss, das Kraftwerk wurde endgültig stillgelegt. Nicht nur die Klimaziele, sondern auch wirtschaftliche Erwägungen spielten dabei eine Rolle: „Angesichts der Anforderungen an die Stromproduktion in der heutigen Zeit hat auch das Unternehmen das Werk, das für die Verhältnisse in den 1980er und 1990er Jahren konzipiert worden war, nicht mehr für wirtschaftlich gehalten“, sagt Heiko Deterding aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Kraftwerkes.
Der in absehbarer Zeit folgende Rückbau des Kraftwerks ist ein aufwendiger und langwieriger Prozess, der eine sorgfältige Planung sowie strenge Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Zunächst müssen alle Systeme entleert, gereinigt und sicher abgebaut werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der fachgerechten Entsorgung von Betriebsmitteln und Schadstoffen, die sich in alten Anlagen befinden. Ein wesentlicher Aspekt des Rückbaus ist die Trennung und Entsorgung der Materialien. Viele der Kraftwerkskomponenten, insbesondere auch die ausgedienten Maschinen, bestehen aus hochwertigen Metallen und anderen Materialien, die jetzt praktisch nur noch „Edelschrott“ darstellen. Parallel zum Rückbau verringert sich auch die Belegschaft des Kraftwerks. Diese wurde bereits erheblich reduziert. Bis zum Jahr 2027 wird voraussichtlich eine Restbesetzung von weniger als zehn Mitarbeitern für die verbleibenden Rückbauaufgaben verantwortlich sein.
Thema Batteriespeicher
Nach der Stilllegung des Kraftwerks hat Uniper in ein modernes Batteriespeichersystem investiert, das in Teilen bereits installiert ist. Die Anlage besteht aus 26 Batteriecontainern, von denen jeweils zwei mit einem Transformator verbunden sind. Die Kapazität der kompletten Anlage beträgt 50 MW, die Investitionskosten belaufen sich auf rund 52 Millionen Euro. Batteriespeicher dienen der Speicherung überschüssigen Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, der bei Bedarf wieder ins Netz eingespeist werden kann. Als Teil der zukünftigen Energieinfrastruktur soll diese Technologie dabei helfen, das Stromnetz zu stabilisieren und erneuerbare Energien flexibler zu nutzen, indem die Speicher Lastspitzen abfangen und die Netzfrequenz stabilisieren. Ungelöst am Standort in Lahde ist nach wie vor die Anbindung des Batteriespeichers an das Stromnetz. Heiko Deterding erklärt dazu: „Die Errichtung der Anlage war kein Problem. Das Dilemna steckt in der Netzeinspeisung. Es wurde angenommen, dass ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 50 MW keine Probleme bereiten würden, da ja zuvor vom Kraftwerk 875 MW in die Leitungen eingespeist wurden.“ Doch genau hier zeigt sich das Problem: Während der Netzbetreiber Avacon den Batteriespeicher mit 50 MW als zu leistungsstark für das Mittelspannungsnetz betrachtet, sieht der Höchstspannungsnetzbetreiber TenneT die Einspeisung als zu gering an, um eine Anbindung an sein Netz zu rechtfertigen. Westfalen Weser Netz als dritter möglicher Partner wiederum prüft noch, ob und wie der Speicher integriert werden könnte. Diese Umstände führen dazu, dass die Batteriespeicher zwar bereitstehen, aber nicht genutzt werden können. Dass diese Entwicklung beim Betreiber Uniper angesichts der beträchtlichen Investitionskosten für Missfallen sorgt, ist verständlich. Es ist aber auch eine verpasste Chance für die Energiewende, wenn benötigte Speicherkapazitäten ungenutzt bleiben, weil netztechnische Aspekte die Umsetzung der nächsten Schritte verhindern.

Solarstrom sichert Versorgung im Kieswerk
Erfolgreicher funktioniert die Eigenstromversorgung durch Photovoltaikanlagen in der Baustoffindustrie. Entsprechende Anlagen prägen auch die Landschaft rund um zwei Kiesabgrabungen zwischen Windheim und Ilse und liefern nachhaltige Energie. Baustoffhersteller Meyer Büchenberg versorgt mit eigenen PV-Anlagen alle Standorte des Unternehmens – das Kieswerk in Ilse, die Betonwerke und die Verwaltung.
„Bis auf die Radlader wird im Kieswerk in Ilse die gesamte Produktion, die Gewinnung wie auch die Aufbereitung, seit 2019 mit eigenen Strom versorgt. Mit einer installierten Leistung von 1.938 kW erzeugen unsere Anlagen durchschnittlich 1,7 Millionen Kilowattstunden jährlich“, sagt Jan-Henrik Meyer. Besonders effizient: Produktionsanlagen lassen sich flexibel je nach Intensität der Sonneneinstrahlung fahren. So wird die Anlage optimal genutzt und hoher Energieverbrauch ausgeglichen. Dazu gewährleistet die eigene PV-Anlage die Unabhängigkeit von Stromanbietern und schwankenden Preisen. „Die Investitionen haben sich schnell amortisiert.“ Neben wirtschaftlichen Vorteilen sieht Jan-Henrik Meyer weitere Gründe für den Ausbau erneuerbarer Energie. Demnach zeigt sich die Entwicklung, dass Kunden ihre Zulieferer zunehmend nach deren CO2-Fußabdruck bewerten. Unternehmen mit erneuerbarer Energie können sich auf diese Weise Wettbewerbsvorteile sichern.
Energie aus Biogas
Auch in unserer Region ist die Nutzung von Biogas ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, da der damit gewonnene Strom bedarfsgerecht ins Netz eingespeist werden kann. Im Stadtgebiet von Petershagen produzieren derzeit vier Anlagen Biogas. „Meine Anlage hat die Kennnummer Kennnummer 001. Sie war die erste ihrer Art in Ostwestfalen“, sagt Rüdiger David aus Ovenstädt, dessen Anlage ausschließlich auf die Verwertung organischer Abfälle setzt. Im Unterschied dazu nutzen Nawaro-Biogasanlagen (Nachwachsende Rohstoffe) gezielt angebaute Pflanzen wie Mais zur Energiegewinnung. Die Anlage von David Ovenstädt zeichnet sich durch eine breite Palette verwerteter Abfälle aus. Von Reststoffen aus der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion bis hin zu Gelatineresten finden hier Abfälle, die andernorts entsorgt würden, eine nachhaltige Nutzung. Ein detaillierter Annahmekatalog regelt genau, welche Abfälle aus den umliegenden Regionen Minden und Nienburg in die Anlage geliefert werden dürfen.
Uchte setzt auf Windkraft und Biogas
Die ländlich geprägte Region der Samtgemeinde Uchte mit weitläufigen Flächen ohne Bebauung bietet ideale Voraussetzungen für den Einsatz von Windrädern. Der geordnete Ausbau von Windparks in der Samtgemeinde dokumentiert dieses Potential. „Mit dem Beginn der Biogasanlagen vor etwa 20 Jahren hat das Thema regenerative Energien in der Samtgemeinde eine enorme Entwicklung genommen. Neben den Windparks verfügt die Samtgemeinde mittlerweile über elf Biogasanlagen, von denen auch Immobilien der Samtgemeinde und das Freibad mit Nahwärme versorgt werden. Wir müssen die Energiewende hinbekommen, denn zurück geht es nicht“, betont Bernd Müller aus dem Bereich Wirtschaftsförderung der Samtgemeinde. Moderne Windkraftturbinen erreichen Wirkungsgrade von bis zu 50 Prozent und liefern an optimalen Standorten, auf freien Flächen oder Anhöhen, zuverlässig Strom – wenn der Wind entsprechend weht. Dank technischer Weiterentwicklungen sind heutige Windräder leistungsstärker, langlebiger und leiser als frühere Modelle. Für die Akzeptanz in der Bürgerschaft ist vor allem die Wahl der Standorte für Windkraftanlagen, die Nähe zur Wohnbebauung entscheidend. Die Samtgemeinde Uchte setzt hier auf eine strategische Planung, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Faktoren berücksichtigt, um den gesetzlich vorgeschriebenen Raum für Windenergieanlagen zur Verfügung stellen zu können. Dementspechend wird der Flächennutzungsplan kontinuierlich angepasst, um eine nachhaltige Weiterentwicklung der Windenergienutzung sicherzustellen. Auch über die Energiefrage hinaus setzt die Kommune auf eine nachhaltige Entwicklung auf Basis einer breit aufgestellten Bürgerbeteiligung. Im vergangenen September wurde die Samtgemeinde als „Nachhaltige Kommune“ zertifiziert. Zum Thema Nachhaltigkeit wurden in Workshops und Arbeitsgruppen konkrete Ziele und ein Maßnahmenkatalog definiert, um die Samtgemeinde gemeinsam nachhaltiger zu gestalten.
Die Rolle der Verwaltung in der Energiewende
Im Gespräch mit Kay Busche, dem Leiter des Bauamtes der Stadt Petershagen, wird deutlich, welche zentrale Rolle die Verwaltung vor Ort beim Ausbau erneuerbarer Energien in der täglichen Praxis spielt. Zwar gibt es keine feste Vorgabe, wie viel Kommunen zur Energiewende beitragen müssen, aber die Kommunalverwaltungen sind durch Gesetze, Förderprogramme und Klimaziele, die auf der politischen Ebene definiert wurden, stark eingebunden. So machen etwa das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Vorgaben für Effizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien. Damit werden die kommunalen Bauverwaltungen praktisch zu Schlüsselakteuren der Energiewende, indem sie etwa Flächen für Windenergieanlagen oder Solarparks ausweisen, Bauprojekte auf Energievorgaben prüfen und nachhaltige Konzepte entwickeln sollen, um klimafreundliche Städte zu gestalten. „Ein zentraler Punkt der Energiewende sollte die Sanierung bestehender Gebäude sein, denn Wärmedämmung und moderne Heiztechniken können den Energieverbrauch erheblich reduzieren“, sieht der Bauamtsleiter Herausforderungen auch jenseits der Energieproduktion. Und berichtet dann über praktische Probleme, mit denen die Verwaltung im Genehmigungsverfahren auch für manche nachhaltige Projekte wie den Batteriespeicher am Kraftwerk Heyden konfrontiert werden. Überraschend auch der Hinweis: „Ein unerwarteter Effekt des Eigenverbrauchs durch Photovoltaikanlagen ist das Nachlassen des Sparbewusstseins“, sagt Kay Busche. Steigende Energiepreise führen oft zu einem bewussteren Stromverbrauch – dieser Anreiz fällt bei Eigenstromnutzung teilweise weg. Private Haushalte mit eigener PV-Anlage neigen dazu, mehr Energie zu verbrauchen, weil keine direkten Kosten spürbar sind. Langfristig könnte dies die Netzinfrastruktur belasten.